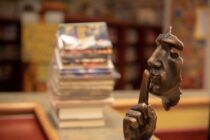Stand: Juli 2024
Guinea ist ein frankophoner Staat an der westafrikanischen Küste mit ca. 13 Mio. Einwohner*innen. Derzeit befindet sich das Land in einer Übergangsphase, nachdem es am 5. September 2021 einen Staatsstreich gab.
Zu den größten menschenrechtlichen Problemen in Guinea gehört die rechtswidrige Gewalt durch Sicherheitskräfte, durch die in den letzten Jahren hunderte Menschen um Leben gekommen sind. Zudem ist die Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Weitere zentrale Probleme sind sexualisierte Gewalt und Straflosigkeit.
Politischer Hintergrund
Von 1984 bis 2008 wurde Guinea diktatorisch von Lansana Conté regiert, der bei fadenscheiniger demokratischer Fassade seine Regierung auf Gewalt gründete. Nach dem Tod Contés im Dezember 2008 putschte Kapitän Moussa Dadis Camara und ernannte sich selbst zum Staatschef. Ein Jahr später wurde er bei einem Attentat verletzt und floh nach Marokko.
Im Juni 2010 führte eine Übergangsregierung unter Sékouba Konaté schließlich demokratische Präsidentschaftswahlen durch, bei denen Alpha Condé, der lange Zeit im Exil gelebt hatte, zum Präsidenten gewählt wurde. 2015 wurde er wiedergewählt.
Im Oktober 2020 wurden erneut Präsidentschaftswahlen abgehalten, die Alpha Condé ebenfalls für sich entschied, nachdem er sich durch eine Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit ermöglicht hatte. Die Lage war bereits im Vorfeld der Wahl extrem angespannt und es kam immer wieder zu Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, zu exzessiver Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte und zu willkürlichen Verhaftungen.
Am 5. September 2021 gab es einen Staatsstreich in Guinea. Angehörige des guineischen Militärs – Mitglieder des sogenannten „Nationalen Komitees zum Zusammenschluss und zur Entwicklung“ (Comité national du rassemblement et du développement – CNRD) ergriffen die Macht. Der Chef der Militärregierung, General Mamady Doumbouya, kündigte im Oktober 2022 an, dass die Übergangsphase zur Rückkehr zu einer zivilen Regierung ab dem 1.1.2023 zwei Jahre dauern soll.
Nach anfänglichen positiven menschenrechtlichen Entwicklungen unter der Übergangsregierung, zum Beispiel der Freilassung politischer Gefangener, ist Amnesty International aktuell besorgt über Menschenrechtsverletzungen, insbesondere über das geltende Demonstrationsverbot.
Menschenrechte
Meinungsfreiheit
Am 31. Oktober 2023 entschied der ECOWAS-Gerichtshof, dass Guinea gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit verstoßen hat, indem es den Zugang zum Internet und zu sozialen Medien im Jahr 2020 eingeschränkt hat.
Der Zugang zu den wichtigsten sozialen Netzwerken ist seit dem 24. November 2023 unterbrochen, ohne dass die Behörden eine offizielle Erklärung dafür abgegeben haben. Der Zugang zu sozialen Netzwerken und Nachrichten-Websites wurde bereits im Mai während der Proteste gegen die Regierung für etwa eine Woche unterbrochen. Am 30. November 2023 erklärte Ousmane Gaoual Diallo, Minister für Post, Telekommunikation und Digitalwirtschaft, dass es kein Recht auf Internet gebe. Er hatte die Unterbrechung des Internetzugangs eingeräumt, sie aber auf ein technisches Problem mit einem Unterseekabel zurückgeführt. Die Nachrichten-Website Guineematin.com war vom 15. August bis zum 5. November 2023 ohne Angabe von Gründen nicht erreichbar. Am 6. und 9. Dezember 2023 forderte die Oberste Kommunikationsbehörde Canal+ Guinée schriftlich auf, die Ausstrahlung von Djoma FM und TV, Espace FM und TV sowie Évasion FM und TV aus „Gründen der nationalen Sicherheit“ einzustellen. Ein anderer Sender, StarTimes, kündigte die Einstellung von Djoma TV, Espace TV und Évasion TV aus denselben Gründen an.
Versammlungsfreiheit
Im Mai 2022 untersagte die Übergangsregierung alle Demonstrationen „auf öffentlichen Straßen, die den sozialen Frieden und die korrekte Durchführung der im Zeitplan vorgesehenen Aktivitäten gefährden könnten” zunächst bis zum Beginn des Wahlkampfs. Auch 2023 wurden in Conakry Versammlungen der Opposition verboten. Mehrere Kundgebungen zur Unterstützung des Staatschefs wurden jedoch zugelassen.
Am 1. Juni 2023 verurteilte das Gericht in Kankan in erster Instanz zwei Frauen zu je sechs Monaten Haft – davon vier auf Bewährung – und einer Geldstrafe von 1 Mio. GNF (ca. 110 EUR) sowie sieben Frauen zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe von 500.000 GNF (ca. 55 EUR). Alle neun wurden wegen „krimineller Teilnahme an einer Versammlung“ verurteilt, nachdem sie am 24. Mai 2023 an einer Demonstration teilgenommen hatten, um die Rückkehr des ehemaligen Präsidenten Alpha Condé an die Macht zu fordern.
Nach gewalttätigen Protesten in der Nacht vom 27. auf den 28. März 2023 in Kankan gegen die fehlende Stromversorgung, bei denen ein Bild des Präsidenten verbrannt wurde, verurteilte das erstinstanzliche Gericht der Stadt 15 Personen zu Haftstrafen zwischen vier und 18 Monaten, unter anderem wegen unerlaubter Versammlung.
Amnesty International weist darauf hin, dass guineische Staatsangehörige nach den internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen des Landes das Recht haben, ihre Meinung durch friedliche Proteste zu äußern.
Rechtswidrige Gewalt durch Sicherheitskräfte
Rechtswidrige Gewalt durch Sicherheits- und Verteidigungskräfte, die in den allermeisten Fällen straflos bleibt, ist eines der schwerwiegendsten Menschenrechtsprobleme in Guinea. Seit 2019 wurden mindestens 113 Menschen von Verteidigungs- und Sicherheitskräfte bei Demonstrationen unter der aktuellen und der Vorgängerregierung getötet und Hunderte schwer verletzt.
Trotz der Versprechen der Übergangsregierung CRND, das Problem der exzessiven Gewaltanwendung und rechtswidriger Tötungen unter Alpha Condé anzugehen, bestehen diese schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen weiter, wie der Bericht „Une jeunesse meurtrie: Urgence de soins et de justice pour les victimes d’utilisation illégale de la force en Guinée“ (auf Deutsch in etwa: „Verletzte Jugend: Medizinische Versorgung und Gerechtigkeit für Opfer rechtswidriger Gewaltanwendung in Guinea dringend erforderlich“) zeigt. Von den insgesamt mindestens 47 Personen, die bis zum 22. April 2024 bei Protesten unter der aktuellen Regierung getötet wurden, waren laut einer Zählung von Amnesty International über 75 % jünger als 25 Jahre und 40 % jünger als 18 Jahre. Ein großer Teil der für den Bericht befragten Verletzten waren ebenfalls Kinder und Jugendliche. Weitere Informationen zu diesem Thema und wie ihr euch für die Betroffenen einsetzen könnt, findet ihr hier.
Am 25.6.2019 hat die Nationalversammlung Guineas ein Gesetz erlassen, das Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte in verschiedenen Fällen rechtfertigt. Zwar soll laut dem Gesetz nur dann Gewalt angewendet werden, wenn dies notwendig und angemessen ist, jedoch wird nicht deutlich gemacht, dass nur dann von Schusswaffen Gebrauch gemacht werden darf, wenn die Gefahr besteht, dass Personen getötet oder schwer verletzt werden, wie es in internationalen und afrikanischen Menschenrechtsstandards vorgesehen ist. Weiterführende Informationen zu dem Gesetz findet ihr hier.
Ein Fall, mit dem sich Amnesty International seit vielen Jahren befasst, ist die Ermordung von Thierno Sadou Diallo am 7. Mai 2015 durch Sicherheitskräfte. Nun kämpft seine Frau Aissatou Lamarana Diallo dafür, dass der Tod ihres Mannes aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Hier findet ihr Informationen, wie ihr sie unterstützen könnt.
Willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen
Am 16. Oktober 2023 wurden 13 Journalist*innen in Kaloum, Conakry, gewaltsam und willkürlich verhaftet, auf das zentrale Polizeirevier gebracht und dann vor dem Gericht erster Instanz angeklagt. Sie hatten an einer friedlichen Demonstration teilgenommen, die vom guineischen Presseverband organisiert worden war, um von den Behörden die Aufhebung der Zugangsbeschränkungen zu bestimmten Nachrichten-Websites zu fordern. Sie wurden am selben Tag wieder freigelassen, nachdem sie wegen „Teilnahme an einer illegalen Versammlung auf einer öffentlichen Straße“ angeklagt worden waren.
Sexualisierte Gewalt
Lange Zeit war sexualisierte Gewalt in Guinea ein Tabuthema, doch in den letzten Jahren rückt das Thema immer mehr in die Öffentlichkeit. Im November 2021 sorgte ein Fall für besonders großes Aufsehen: M’Mah Sylla wurde mutmaßlich von Ärzten in einer nicht zugelassenen Klinik in Conakry vergewaltigt, als sie sich behandeln lassen wollte. Als sie daraufhin schwanger wurde, wollte sie das Kind in derselben Klinik abtreiben lassen. Dabei sei sie erneut vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie trotz sieben chirurgischer Eingriffe Ende November 2021 verstarb. Zahlreiche Frauen demonstrierten daraufhin in verschiedenen guineischen Städten, um Gerechtigkeit für die Überlebende von Vergewaltigung zu fordern.
Am 4. April 2023 wurden vier Männer vom erstinstanzlichen Gericht in Mafanco, Conakry, wegen Vergewaltigung und anderer Misshandlungen, die zum Tod von M’Mah Sylla führten, zu Haftstrafen zwischen einem und 20 Jahren verurteilt. Die Täter wurden außerdem dazu verurteilt, dem Vater des Opfers 1 Milliarde GNF (rund 110.000 EUR) Schadensersatz zu zahlen.
Der im September 2022 veröffentlichte Bericht „Shame must change sides: Ensuring rights and justice for victims of sexual violence in Guinea“ befasst sich ebenfalls mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Zentrale Ergebnisse des Berichts findet ihr hier.
Am 18. Oktober 2023 forderten die UN-Organisationen in Guinea die Behörden auf, ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen nachzukommen, nachdem vier Tage zuvor ein neunjähriges Mädchen nach einer Vergewaltigung in Dubréka in der Region Kindia gestorben war.
Massaker vom 28. September 2009
Am 28. September 2009 rief eine Koalition aus politischen Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer friedlichen Demonstration im Stadion von Conakry auf, um gegen die autoritäre Regierung des damaligen Präsidenten Camara und seine Kandidatur bei den für Januar 2010 angesetzten Präsidentschaftswahlen zu protestieren. Die Sicherheitskräfte beendeten diese Demonstration gewaltsam. Mehr als 150 Personen wurden dabei außergerichtlich hingerichtet, über 1500 verletzt, und viele Frauen öffentlich vergewaltigt.
Seitdem setzt sich Amnesty International für Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Angehörigen ein. Im September 2022 – 13 Jahre nach dem Massaker – wurde der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter eröffnet. Der Prozessauftakt ist ein erster Schritt, um der Straflosigkeit ein Ende zu setzen. Damit tatsächlich Gerechtigkeit walten kann, muss nun sichergestellt werden, dass die Taten vollständig aufgeklärt werden und allen Angeklagten in ihrer Anwesenheit ein faires Verfahren gemacht wird. Die guineischen Behörden müssen auch die Sicherheit der Betroffenen, der Zeug*innen und anderer gefährdeter Personen gewährleisten. Außerdem ruft Amnesty International die internationalen Partner Guineas auf, zu einem Fonds für die Entschädigung der Opfer beizutragen.
Die Anhörungen wurden im Herbst 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft und wegen eines Anwaltsstreiks für drei Wochen unterbrochen. Am 13. November wurde der Prozess jedoch wieder aufgenommen – neun Tage nachdem ein bewaffnetes Kommando das Gefängnis von Conakry angegriffen und vier der Hauptangeklagten, darunter Moussa Dadis Camara, befreit hatte. Mit Ausnahme von Claude Pivi, dem ehemaligen Minister für die Sicherheit des Präsidenten, konnten alle wieder festgenommen werden.
Recht auf eine gesunde Umwelt
Im März 2023 ließ der Präsident offiziell die Arbeiten an der Eisenerzmine Simandou wieder aufnehmen, die auch den Bau einer Eisenbahnlinie und eines Hafens umfassen soll, obwohl zivilgesellschaftliche Organisationen Bedenken hinsichtlich der Folgen für die wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Anwohner*innen und der Auswirkungen auf den Klimawandel äußerten.
Nachdem 500 Fischer*innen über Hautausschläge geklagt hatten, führten die guineischen Behörden am 14. April 2023 eine Untersuchung durch und stellten 74 km vor der Küste von Conakry große Verschmutzungsflächen fest. Am 19. Juni 2023 beantragte das Justizministerium beim Gericht zur Verfolgung von Wirtschafts- und Finanzdelikten die Einleitung eines Verfahrens wegen „mutmaßlicher Meeresverschmutzung, die Hautausschläge bei Kleinfischer*innen und Umweltschäden verursacht hat“.
LGBTI
Homosexuelle Handlungen sind sowohl unter Männern als auch unter Frauen in Guinea illegal und werden mit Haft von sechs Monaten bis maximal drei Jahren bestraft. Offiziell gaben die Behörden bei der universellen, regelmäßigen Überprüfung 2015 an, das Gesetz werde nicht angewendet. Es wurden jedoch in den vergangenen Jahren mindestens fünf Personen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermuteten sexuellen Orientierung festgenommen.
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche (LGBTI) werden in Guinea häufig stigmatisiert und bedroht und Hassverbrechen sind keine Seltenheit.
Todesstrafe
Mit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzes im Oktober 2016 wurde die Todesstrafe im allgemeinen Recht abgeschafft, bestand jedoch im Militärrecht weiterhin fort. Im Juni 2017 verabschiedete die Nationalversammlung schließlich ein neues Militärstrafrecht, mit dem die Todesstrafe in Guinea endgültig abgeschafft wurde.
Amnesty International fordert die Regierung Guineas auf,
- das Demonstrationsverbot aufzuheben und das Recht, sich friedlich zu versammeln, zu wahren;
- willkürlich festgenommene Oppositionelle und Aktivist*innen freizulassen und keine weiteren Personen festzunehmen, die lediglich ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen;
- umfassende Ermittlungen zu den Vorwürfen der exzessiven Gewaltanwendung und der Folter einzuleiten und ggf. die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen;
- ihre Anstrengungen zur Prävention sexualisierter Gewalt deutlich zu verstärken und den Zugang zu medizinischer Versorgung von Betroffenen zu verbessern;
Hier findet ihr weitere Artikel und Berichte von Amnesty International zur Menschenrechtslage in Guinea.
Aktuelle Beiträge zu Guinea